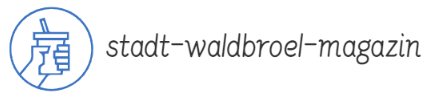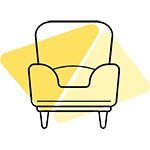

Systeme im Bruch – Kurzkritiken vom Remake-Festival
- Von stadt-waldbroel-magazin/li>
- 807
- 07/07/2022
Erzählen, was nie erzählt wird, zeigen, was nie gezeigt wird: Die dritten Frankfurter Frauen Film Tage widmeten sich unsichtbarer oder nicht anerkannter Arbeit – und vielfältigen Formen des Widerstands. Notizen von Studierenden der FU Berlin.
Die dritte Ausgabe des Festivals Remake. Frankfurter Frauen Film Tage widmete sich dem Schwerpunktthema „… weil nur zählt, was Geld einbringt“: Frauen, Arbeit und Film und damit vielfältigen Aspekten unsichtbarer oder nicht anerkannter Arbeit: in Küche, Haushalt und Beziehungen, in Fabriken und Büros, auf dem Filmset, in der Dorfgemeinschaft – in den Blick geraten dabei nicht nur Feminisierung, Migrantisierung und Sexualisierung von Arbeit, sondern auch unterschiedlichste Formen von Widerstand gegen Diskriminierung und Ausbeutung.
Tôi ippon no michi / The Far Road (JP 1977; Regie: Sachiko Hidari)
Der Vater, allein in seinem Zimmer. Er ist ausgerastet, hat seinen Sohn geschlagen, seine Familie angeschrien, den Tisch umgeworfen – ein klaustrophobischer Blick in die zu enge Wohnung. Ausgangspunkt von The Far Road ist ein System im Bruch – die Tochter will selbst entscheiden, wen sie heiratet; Mutter und Bruder stehen auf ihrer Seite. Der Vater scheint die Welt nicht mehr zu verstehen. Seine Arbeit in der Gleisbettpflege für die japanische Eisenbahn ist genauso prekär wie seine Macht in der Familie.
Dieses Verhältnis zwischen Tradition und Moderne, manueller und maschineller Arbeit, Patriarchat und Emanzipation führt uns durch ein wankendes Epos. Das fossile Hokkaidō ist ein Ort, der der Zeit hinterherhinkt. Alle müssen permanent daran arbeiten, mit der Veränderung Schritt zu halten. Jede neue Maschine wird kritisch begutachtet; sie scheinen nicht ins starre System zu passen.
Doch der Wandel geschieht – während die junge Generation in ihren Rollen flexibler ist, mühen sich die Alten ab, Neues zu lernen; die Frauen suchen einen Platz außerhalb der häuslichen Sphäre, die Männer Arbeit jenseits ihrer Hände. In der Mitte stehen stets Familie und Gewerkschaft, Institutionen, in denen sich die Geschlechter-, Klassen- und Generationskonflikte abspielen. Am Ende bleibt die Frage, was es sich zu behalten lohnt. Die Insel des Sonnenuntergangs ist verlassen, die Entscheidung der Tochter akzeptiert, der Blick geöffnet – der elektrische Zug bleibt trotzdem ein unheimlicher Ort.
C. Stetzuhn
Ekmek parası / Geld fürs Brot (DE 1994; Regie: Serap Berrakkarasu)
Serap Berrakkarasu und Gisela Tuchtenhagen finden in einer Lübecker Fischfabrik verschiedene weibliche Perspektiven. Die Geschichte von müden Händen, die immer wieder dieselben Bewegungen an einem laufenden Band wiederholen, ist nicht nur auf die Arbeit in der Fabrik beschränkt; der Film erzählt auch von den Veränderungen und Schwierigkeiten, die Frauen aus der Türkei bei der Migration und Frauen aus Mecklenburg bei der Wiedervereinigung Deutschlands erleben.
Berrakkarasu und Tuchtenhagen sind mit einer 16-mm-Kamera zu Gast in den Häusern dieser Frauen. Mit ihrer Ausdrucksweise und ihren Fragen gelingt es Berrakkarasu, dass sich die Frauen verstanden fühlen und das Publikum mit ihnen mitfühlen kann. Dank der offenherzigen Beziehung der Regisseurin zu den Porträtierten wirkt alles natürlich und real. Die stillen Momente im Film werden von Gesichtsausdrücken gefüllt. Obwohl sie unterschiedliche Hintergründe haben, erzählen alle Frauen, denen die gesamte Verantwortung für die Kindererziehung sowie die ganze Hausarbeit überlassen wurde, vom gleichen Kampf ums Leben.
Das Ergreifendste an Ekmek parası ist, dass es in der Fischfabrik kaum Träume und Hoffnungen gibt und die Frauen trotzdem nicht aufhören zu singen und zu tanzen – und so endet der Film.
Ceren Özyurt
Dzień za dniem / Tag für Tag (PL 1988; Regie: Irena Kamieńska)
Der Schwarzweißfilm ist ganz auf die anstrengende Arbeit fokussiert, auf das Werfen der Ziegel. Die Frauen arbeiten gemeinsam in dem Glauben, dass ihre Mühe eine bessere Zukunft bringen wird. Die Gefühle und Erinnerungen einer von ihnen werden im Voice-over vorgestellt. Sie beschreibt die beschwerliche physische Arbeit, die ihr ganzes Leben bestimmt. Die Bilder zeigen dazu die depressive Vision eines Polens der Nachkriegszeit, in Ruinen arbeitende Menschen.
Der Film berichtet über die Hoffnung der polnischen Nation nach dem Krieg. Er operiert ähnlich wie kommunistische Propagandafilme, indem er anhand eines Beispiels die Geschichte der ganzen Bevölkerung erzählt. Es wird auch die einzige vom Stalinismus gelieferte Hoffnung vorgeführt. Die großen Defilees mit von den Massen getragenen Stalin-Porträts sollen daran erinnern, dass die Arbeit einem größeren Ziel dient. In der Montage wird diese idealistische Hoffnung jedoch ständig mit den Bildern von elendigen Lebensbedingungen alltäglicher Menschen kontrastiert.
Auf der Tonspur erzählt die Frau von den Hauspflichten, die sie nach der Arbeit noch zu erledigen hat. In ihrer Stimme spürt man die Enttäuschung von der Realität. Die auffälligste Eigenschaft ihrer Aussagen bleibt die unmenschliche Ermüdung.
Maciej Wierzbicki
Sarangio (DE/IT 1993; Regie: Cinzia Bullo)
Manchmal erinnern sich Menschen mit ihren Augen, Ohren und Fingerspitzen an Geschichten aus kleinen Dörfern, die wie aus einem Märchen wirken. Sowohl im italienischen Dorf Sarangio als auch im gleichnamigen Film stehen zwei solche Frauen im Mittelpunkt: Seit 57 Jahren leben Marina und Adelaide in dem Bergdorf am Lago Maggiore und erinnern sich lebhaft daran, wer gegangen und wer gekommen ist. Das Publikum vor der Leinwand folgt ihren Stimmen. Manchmal verweilen die Bilder in Freeze-Frames. Durch ihre gleichzeitige Entfärbung wirken sie wie aus einem Fotoalbum. Der Film fixiert die Zeit und den Raum des Dorfes. Durch ihn können die Zuschauenden beides erkunden.
Die Geschichten dieses Films sind so klein, dass sie sich nicht außerordentlich anfühlen. Dennoch, wenn es einen Grund gibt, warum Sarangios Geschichten so besonders sind, dann wahrscheinlich wegen der sehr langen, engen und intimen Kommunikation zwischen den wenigen Protagonist*innen in dem so kleinen Dorf. Da Marina und Adelaide viele Informationen unbewusst auslassen, wirken ihre mäandernden Gespräche für außenstehende Personen wenig strukturiert. Aber es entführt uns zugleich auch in eine Nostalgie, die Erinnerungen an unsere eigene Kindheit wachruft, wie die Gespräche der Erwachsenen am Tisch, denen wir aufmerksam zugehört haben, ohne genau zu wissen, worum es eigentlich geht.

Jungwook Ryu
Landfrauen. Drei Generationen auf einem Hof (DE 1978; Regie: Roswitha Ziegler, Niels Bolbrinker)
Der Dokumentarfilm schaut sich wie eine tastende Therapie-Schnuppersitzung – es wird viel geredet, aber wenig gesagt. Großmutter, Mutter und Tochter leben auf einem Hof nebeneinander her. Schweinezucht ist Leidenschaft, Arbeit ist Arbeit und Landwirtschaft ist Vorbestimmung; so lauten ihre Überzeugungen und lassen trotz oder gerade wegen aller Nähe zueinander genug Platz für Reibereien. Ob die selbstgewebten Tischtücher eines Tages vererbt werden; ob lieber eine Melkmaschine angeschafft werden soll; ob man es doch irgendwann mal nach New York schafft: Fragen, die den Alltag dieser Frauen bestimmen. Das Konfliktpotenzial, das unter diesen Oberflächlichkeiten brodelt, tippt der Film ein-, zweimal vorsichtig mit dem Zeigefinger an, anstatt es so barsch für die Zuschauer*innen aufzuschneiden und auszustellen, wie er an einer Stelle die Schlachtung einer Sau zeigt. Konträr dazu Bilder von fröhlich um Oma Hermine (82) herumhopsenden Ferkeln – und auch sonst öffnet die Montage zyklisch wiederkehrende, interne Widersprüche. Helga (45) und ihr Mann haben sich nach vielen Ehejahren nichts mehr zu sagen – das sei ja auch normal. Die 21-jährige Heidrun strebt nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung zur Zahnarzthelferin eine Ehe mit einem Bauern an, um damit ihren vorgefertigten Lebensweg zu verfolgen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft treffen in diesem Werk aufeinander und verschmelzen zu Schweigen.
Iris König
Shoes (USA 1916; Regie: Lois Weber)
Dieser Film bietet einen seltenen Einblick in das Leben einer hart arbeitenden Frau im Jahr 1916. Ihren Lohn muss Eva in Shoes an ihre Familie abgeben, damit die Miete bezahlt werden kann. Sie selbst braucht aber dringend neue Schuhe und muss jeden Tag mit kaputten zur Arbeit gehen. Ihr Vater macht zwar die Ansagen im Haus, geht jedoch selbst nicht arbeiten. Jeden Tag muss sich Eva aus Karton neue Sohlen basteln. Nach drei Tagen Regenwetter lösen sich ihre Schuhe komplett auf, und sie wird krank. Im Laufe des Films stellt sich Eva oft vor, wie es wäre, wohlhabend zu sein. Man bekommt einen Einblick in das Leben, das Eva hätte führen können, wenn sie nicht arm geboren wäre.
Regisseurin und Produzentin Lois Weber greift in Shoes viele soziale Fragen auf. Der Film bietet einen Einblick in die sozialen Bedingungen, unter denen Frauen aus Evas Milieu arbeiten und leben mussten. Erstaunlich ist, wie selbstlos Eva handelt und bereit ist, alles für ihre Familie zu tun, obwohl ihr Vater so undankbar ist. Dass sie sich am Ende prostituiert, um sich endlich neue Schuhe kaufen zu können, erschüttert eine*n als Zuseher*in ebenso sehr wie die Darstellung der sozialen Umstände, die sie dazu gebracht haben, diese Entscheidung zu treffen.
Lina Hoyda
Janine (USA 1990; Regie: Cheryl Dunye)
Janine wirkt schonungslos ehrlich und kommt unverblümt auf den Punkt. Cheryl Dunyes erster Kurzfilm erzählt die Geschichte einer jungen lesbischen schwarzen Frau in ihrer Adoleszenz, die sich mit ihrer Identität auseinandersetzt. Ihre Liebesgeschichte als Teenager bietet einerseits eine Grundlage, mit der sich praktisch alle Zuschauer*innen identifizieren können. Sie dient aber auch als fundamentales Instrument für die filmische Erzählung, die ihren Fokus auf die Klassen- und Identitätsunterschiede zwischen dem Love Interest Janine (dem wohlhabenden, heterosexuellen, weißen Mädchen) und Cheryl (der lesbischen, schwarzen Frau aus einer Arbeiterfamilie) richtet. Zwischengeschnittene Szenen von Cheryls Gesicht und Kerzen erzeugen ein Gefühl der Abkopplung von der Erzählung und schaffen kleine Fenster zur Reflexion für die Zuschauer*innen. Die Zwischentitel hingegen verbinden uns auf eine sehr banale und stereotype Weise mit ihrer Botschaft und Geschichte. Die anekdotische Erzählweise ist ein Ansatz, der später in The Watermelon Woman (USA 1996) aufgegriffen wird. Die Hartnäckigkeit und der Humor der Hauptfigur vermitteln den Eindruck, dass sie trotz aller Schwierigkeiten kämpferisch bleibt.
Amir Naghavialhosseini
À la vie (FR 2021; Regie: Aude Pépin)
Wir begleiten eine Frau mit einem Koffer durch die Stadt. Sie hat ein Ziel. Diese Frau ist Chantal Birman. Sie ist Hebamme, die auch für die Nachsorge zuständig ist. Die Filmemacherin Pépin führt den Film beim Remake-Filmfestival ein: Sie habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Mütter in den Vordergrund zu bringen.
Es gibt unangenehme Momente und den Drang zu helfen. Sei es, der bereits 70-jährigen Hebamme den Koffer die Treppen hochzutragen oder einer Mutter die Tränen wegzuwischen. Wo die Kamera sonst zum schreienden Baby schwenken würde, bleibt sie hier bei der jungen Mutter. Die Einstellungen sind lang und quälend. Für die Intention Pépins sind sie nötig, um das zu erzählen, was nie erzählt wird, um das zu zeigen, was nie gesehen wird. Die Frauen, die Birman besucht, bringen eine besondere Offenheit mit, der ich persönlich nur mit Respekt begegnen kann. Probleme beim Stillen, Familienprobleme und Babyblues bekommen in diesem Film eine ganz eigene Stimme, die Stimme der Frau. Birman selbst berichtet nebenbei aus ihrem Leben. Die Leichtigkeit, mit der sie ihre eigene entsetzliche Geschichte über einen Schwangerschaftsabbruch erzählt, macht diese erträglicher.
Sehr gestellt und fast schon erzwungen wirkt, neben den sich so authentisch äußernden Frauen, der Gang durch die Menge einer Demonstration.
À la vie ist eine bitterschöne Reise einer Frau, die Frauen während der Nachsorge begleitet. Das Ziel, den Blick dieser Frau zu fokussieren, ist Aude Pépin sehr gelungen. Der Film ist unangenehm angenehm, und das macht ihn besonders.
Oona Malinowski
Ein Bild bleibt dem Zuschauer vorerst verwehrt. Die ersten Sekunden von À la vie sind schwarz, alles bleibt unsichtbar. Zwei Frauenstimmen, die miteinander sprechen. Es geht um Geburt. Schnell wird klar, dass wir den Dialog einer Hebamme mit einer Mutter belauschen. Schließlich erscheint sie: eine junge Mutter mit ihren Säugling auf dem Bauch. Es ist dieses Sichtbarmachen, das der Film anstrebt. Chantal Birman, kurz vor dem Ruhestand, ist die Hebamme, in deren Arbeitsrealität man hier entführt werden darf. Episodisch reist sie von einer Mutter zur nächsten, berät, tröstet, untersucht. Ungewohnt ehrlich und unmittelbar sind die Einblicke in die seelische wie auch körperliche Verfassung der Frauen.
Die Kamera bleibt dabei stets unsichtbare Beobachterin. Die Intimität wirkt gänzlich ungestört, wird dadurch vollends glaubwürdig – und doch mag sich der bittere Geschmack geplanter Inszenierung breitmachen. So verweisen die Kameraperspektiven, wenn Birman während eines Gesprächs durch eine Menschenmenge geht, eindeutig auf einen geschnittenen, womöglich gar mehrfach gedrehten Dialog. À la vie ist in der Tat ein Dokumentarfilm, der sich in Teilen um das Gewand eines Spielfilms zu bemühen scheint. Immer wieder wird der Versuch ersichtlich, den szenischen Charakter des Zweitgenannten mit der Nahbarkeit einer Dokumentation zu vereinen. Dennoch gelingt es Aude Pépin auf einzigartige Weise, sichtbar und greifbar zu machen, was selten sichtbar und greifbar scheint: die Frau nach der Geburt.
Michel Cremer
Seite drucken